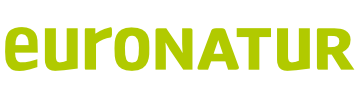Robust und invasiv: Das Wolfsmilchkraut
© Zeleni prsten Public Institution of Zagreb County
Fast wie im Bambuswald: eine Vergesellschaftung des Japanischen Staudenknöterichs
© Ivana SucicWolfsmilchkraut
Das Gewöhnliche Wolfsmilchkraut ist eine robuste, mehrjährige Staude, die 80 bis 150 cm hoch wird. Es hat ein verzweigtes Wurzelgeflecht, aus dessen unterirdischem Teil zahlreiche neue Stängel wachsen. Diese Eigenschaft macht es so erfolgreich bei seiner Verbreitung. Das Wolfsmilchkraut blüht von Juni bis August; im Herbst entwickelt es ca. 8 cm lange Früchte, die eine gewisse Ähnlichkeit zu Papageien aufweisen.
Das Gewöhnliche Wolfsmilchkraut stammt ursprünglich aus dem östlichen Nordamerika. Es wurde im 17. Jahrhundert als Zierpflanze nach Europa eingeführt und ist auch heute noch in vielen Gärten zu finden. Der Neophyt kommt vor allem in Lebensräumen vor, deren Qualität durch menschliche Eingriffe beeinträchtigt ist und wo seine natürlichen Konkurrenten nicht weit verbreitet sind, etwa auf vernachlässigten Feldern und Weiden oder entlang von Straßen und Eisenbahnlinien. Ursprünglich dachte man, dass man diese Pflanze auf vielfältige Weise verwerten kann: Spargelersatz, Isoliermaterial und Naturkautschuk sind nur einige Beispiele. Es stellte sich allerdings bald heraus, dass das Wolfsmilchkraut für die genannten Zwecke wirtschaftlich völlig unrentabel war. Lediglich zur Honiggewinnung lohnt sich der Anbau.
Das Gewöhnliche Wolfsmilchkraut verursacht große direkte Schäden, indem es fruchtbares Land, Weinberge, junge Waldplantagen und Eisenbahnlinien überwuchert und das Wachstum natürlicher Pflanzengesellschaften verhindert. Seine Beseitigung ist teuer und kompliziert. Weidende Schafe etwa sollte man auf einer kleinen Fläche einzäunen, damit sie nicht umhin kommen das Kraut zu verzehren. Aus gesundheitlichen Gründen sollten Schafe allerdings nicht zu viel davon fressen. Auch für den Menschen ist das Gewöhnliche Wolfsmilchkraut nicht ungefährlich. Alle Teile der Pflanze enthalten einen milchigen Saft, der giftig ist und Durchfall, Atemnot, Krämpfe und Gleichgewichtsstörungen verursachen kann.
Knöteriche
Knöteriche sind mehrjährige krautige Pflanzen mit einem starken Wurzelstock (Rhizom). Aus diesen Rhizomen entwickeln sich Sprosse, die über 3 m hoch und etwa 4 cm dick werden können. Die Wurzeln des Knöterichs dringen 1 bis 2 m in die Tiefe und breiten sich weit in die Breite aus. Eine einzige Pflanze kann 200.000 Blüten haben. All dies macht die Knöteriche zu einer sehr erfolgreichen Art in den gemäßigten Breiten der Nordhalbkugel. Als invasive Arten aus der Familie der Knöterichgewächse sind vor allem der Japanischen Staudenknöterich, der Riesenknöterich sowie deren Hybride, der Böhmische Staudenknöterich, problematisch.
Der Japanische Staudenknöterich wurde im 19. Jahrhundert als Zierpflanze nach Europa eingeführt. Es wird vermutet, dass lediglich eine einzige Pflanze nach Europa eingeführt wurde, die sich später durch vegetative Vermehrung in viele europäische Länder ausbreitete. Der Japanische Staudenknöterich besiedelt Grünland, periodisch überschwemmte Gebiete, die Ufer von Bächen und stehenden Gewässern ebenso wie Straßenränder und städtische Gebiete. Die Pflanze gedeiht sehr gut in Gebieten, in denen stickstoffreiche Düngemittel verwendet werden.
Der Japanische Staudenknöterich hat zahlreiche negative Auswirkungen auf die Lebewesen seiner Umgebung. So gibt der Neophyt Stoffe in den Boden ab, die das Wachstum anderer Pflanzen verhindern und die im Boden lebenden Mikroorganismen beeinflussen. Überdies beginnt er früh zu keimen und schnell zu wachsen, womit er andere Pflanzen in den Schatten stellt. Die invasive Art verwertet Nährstoffe aus dem Boden effektiver als ihre Konkurrenten und verhindert das Wachstum anderer Pflanzenarten beinahe vollständig. Der Japanische Staudenknöterich wird für das indirekte Aussterben einiger einheimischer Arten verantwortlich gemacht.
Problematisch gestaltet sich die Entfernung des Knöterichs aus der Landschaft. Die bloße Entfernung der oberirdischen Pflanzenteile ist nämlich nicht zielführend, da es den Ausbruch von noch mehr Pflanzen verursacht. Als beste Methode eignet sich das Ausgraben der Pflanze mitsamt des weit ausgebreiteten Wurzelstocks.